Throwback Thursday: 21 Jahre alter Ecolianer-Artikel über die Schulgemeinde
Die Ausgabe 2004 des Ecolianer enthielt einen reflektierenden Artikel über die Schulgemeinde, die wöchentliche Vollversammlung der Ecole. Der größte Teil des Artikels wurde ursprünglich auf Deutsch verfasst, wobei ein Beitrag — im vierten Bild unten zu finden — bereits auf Englisch vorlag. Der Text enthält Perspektiven von damaligen Führungskräften der Schulgemeinde sowie von Alumni und Mitarbeitern, die untersuchen, wie die Schulgemeinde erlebt wird, welche Herausforderungen sie darstellt und welche Rolle sie bei der Gestaltung des Lebens an der Ecole spielt. Die vollständige englische Übersetzung finden Sie unten.
Die Kommentare stammen, abgesehen von dem Interview mit den Führungskräften der Schulgemeinde, von:
– Armin Lüthi (Mitarbeiter 4.48–3.50, 4.56 ff.)
– Kim Dios (Mitarbeiter 9.95–8.99)
– Chris Gray (Student 9.59–6.61)
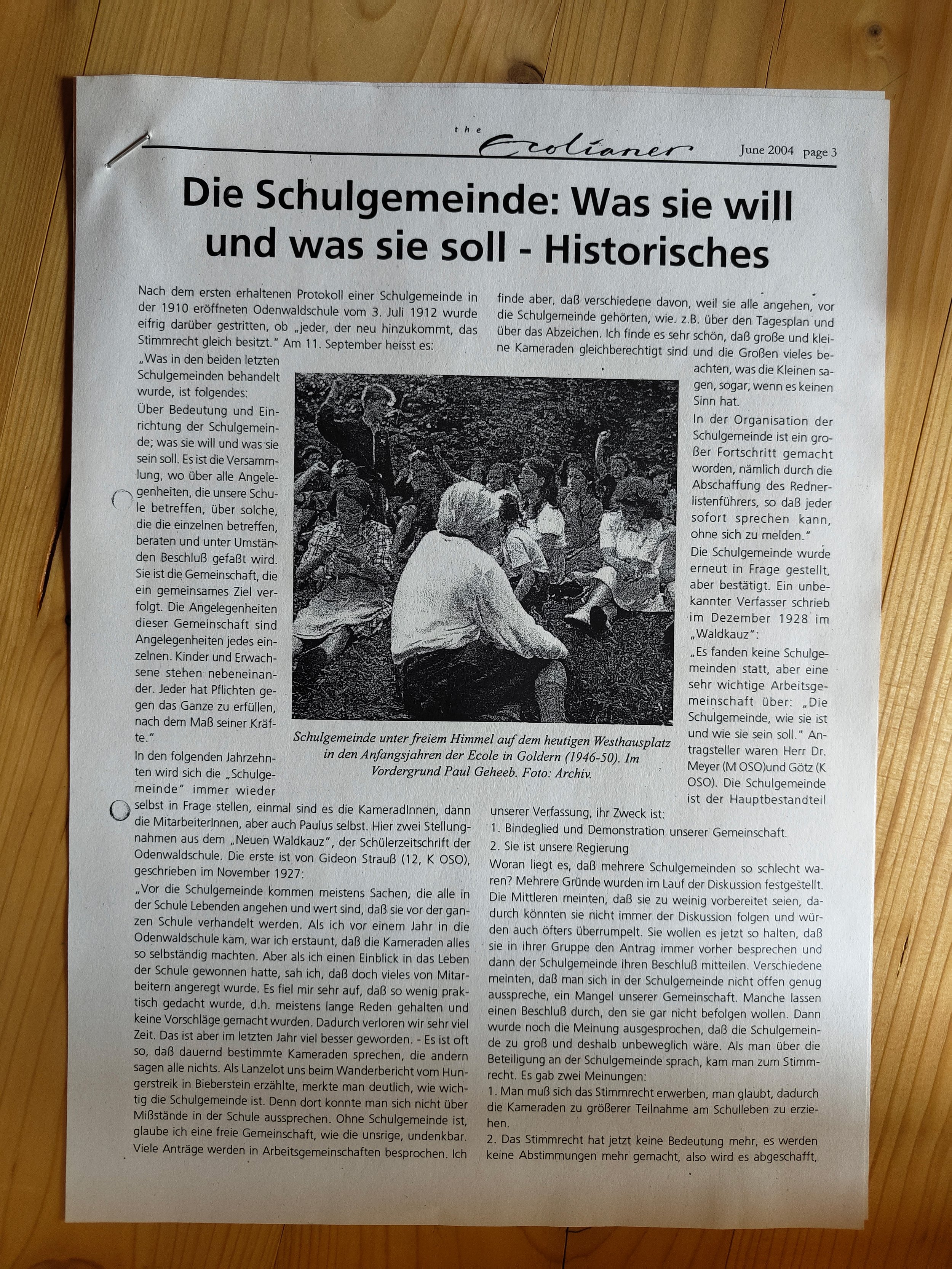
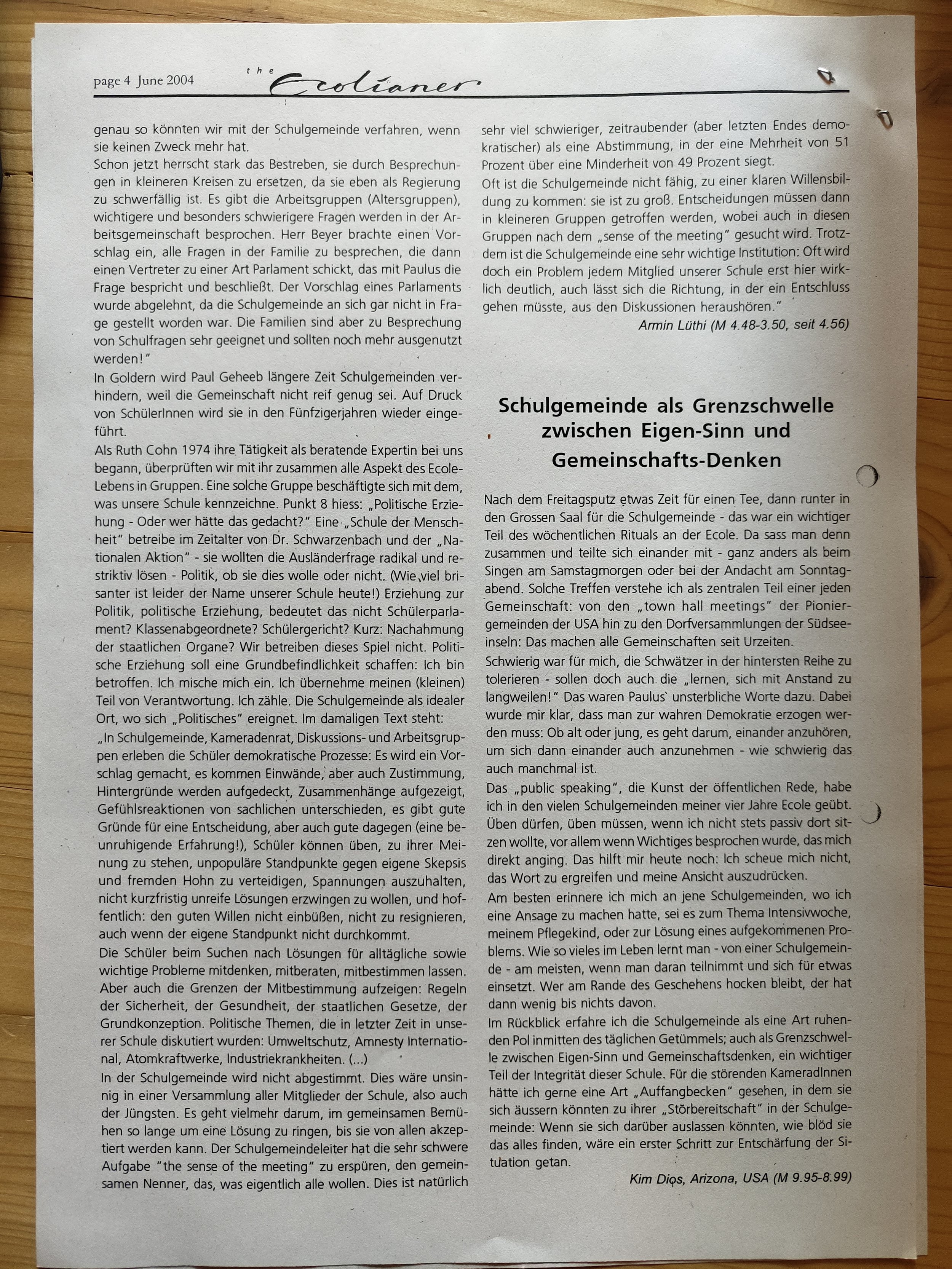
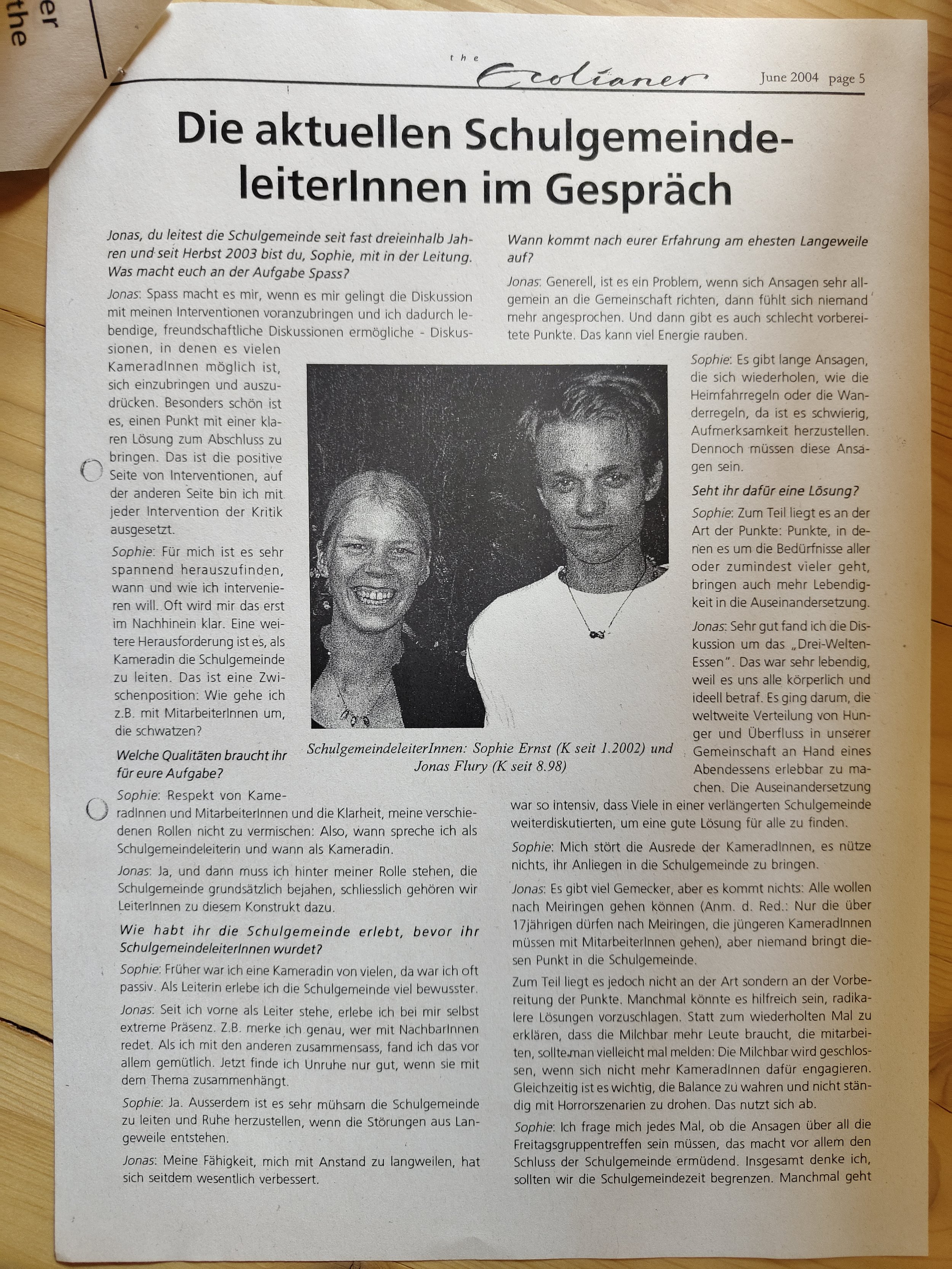
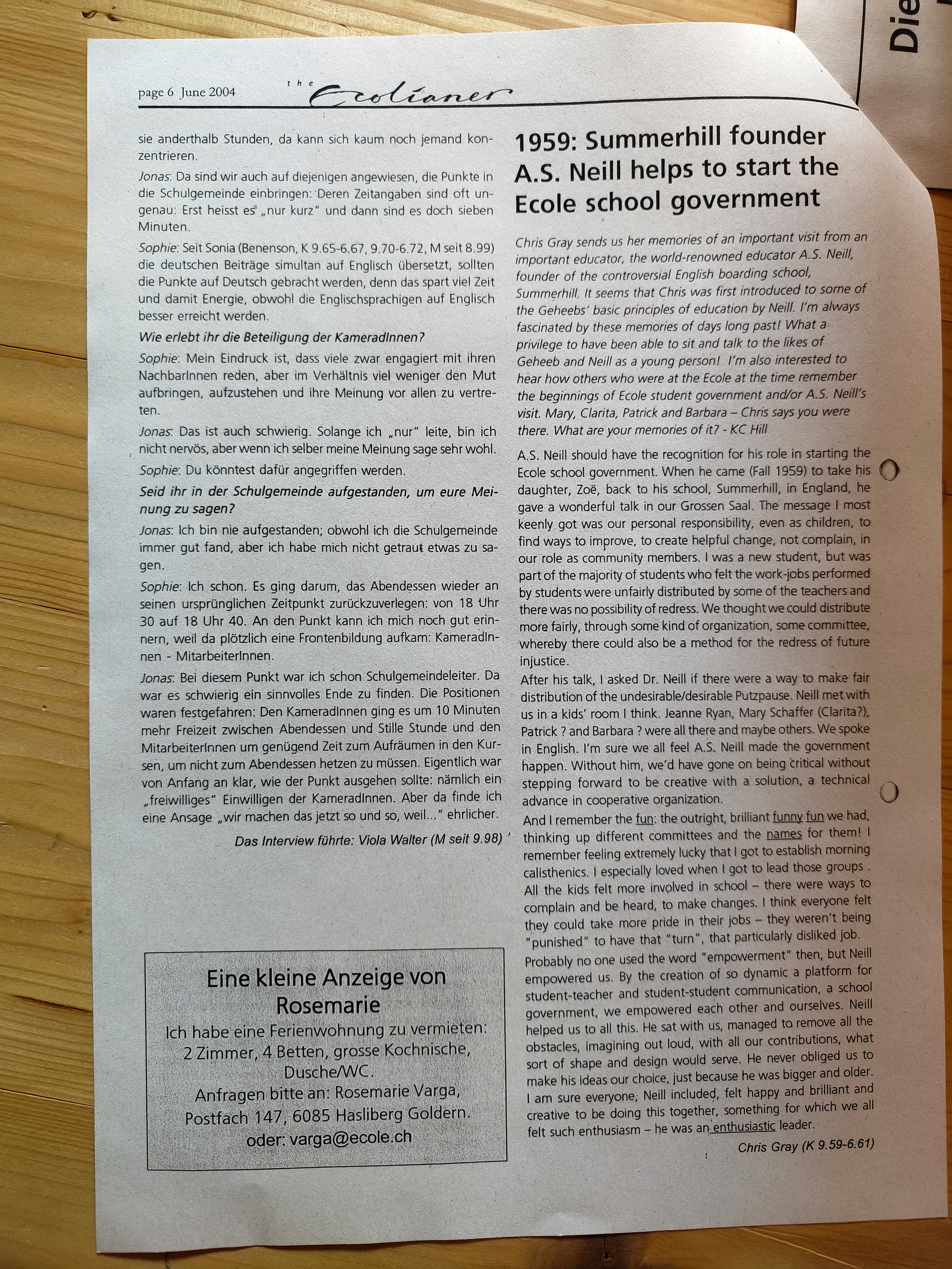
Als PDF herunterladen
Die Schulgemeinde: Was sie will und wozu sie da ist – Eine historische Perspektive
Laut den frühesten erhaltenen Protokollen einer Schulgemeinde an der Odenwaldschule (gegründet 1910) vom 3. Juli 1912 gab es eine lebhafte Debatte darüber, ob “jeder, der beitritt, sofort Stimmrecht haben sollte.” Am 11. September heißt es im Protokoll:
“Was in den letzten beiden Schulgemeinden diskutiert wurde, ist Folgendes: Zweck und Struktur der Schulgemeinde; was sie will und was sie sein soll. Sie ist die Versammlung, in der alle Angelegenheiten, die unsere Gemeinschaft oder Einzelpersonen innerhalb dieser betreffen, diskutiert und unter Umständen entschieden werden. Sie ist das Kollektiv, das ein gemeinsames Ziel verfolgt. Die Anliegen dieser Gemeinschaft sind die Anliegen jedes Einzelnen. Kinder und Erwachsene stehen Seite an Seite. Jeder hat Pflichten gegenüber dem Ganzen, entsprechend seinen Fähigkeiten.”
In den folgenden Jahrzehnten stellte sich die Schulgemeinde immer wieder selbst in Frage – mal durch Schüler*innen, mal durch Mitarbeiter*innen und mal durch Paulus selbst. Hier sind zwei Perspektiven aus dem „Neuen Waldkauz“, der Schülerzeitung der Odenwaldschule. Die erste stammt von Gideon Strauß (12. Klasse, OSO) und wurde im November 1927 geschrieben:
„Angelegenheiten, die alle in der Schule betreffen und es wert sind, von der gesamten Schule diskutiert zu werden, kommen in der Regel in die Schulgemeinde. Als ich vor einem Jahr an die Odenwaldschule kam, war ich überrascht, dass die Schüler*innen alles so selbstständig Schüler*innen . Aber nachdem ich einen Einblick in das Schulleben gewonnen hatte, sah ich, dass vieles tatsächlich von den Lehrkräften initiiert wurde. Mir fiel auch auf, dass es wenig praktisches Denken gab – oft wurden lange Reden gehalten, ohne dass konkrete Vorschläge gemacht wurden. Das hat uns viel Zeit gekostet. Aber das hat sich im letzten Jahr deutlich verbessert. Oft sind es immer dieselben Leute, die reden, während die anderen schweigen. Als Lanzelot uns während eines Wanderberichts von dem Hungerstreik in Bieberstein erzählte, wurde klar, wie wichtig die Schulgemeinde ist. An dieser Schule Schüler*innen Probleme Schüler*innen offen ansprechen. Ich glaube, dass eine freie Gemeinschaft wie die unsere ohne eine Schulgemeinde nicht denkbar ist.“
Viele Vorschläge werden in Arbeitsgruppen diskutiert. Dennoch bin ich der Meinung, dass einige davon, weil sie alle betreffen, in die Schulgemeinde eingebracht werden sollten – zum Beispiel der Tagesablauf oder das Schulabzeichen. Ich finde es wunderbar, dass ältere und jüngere Schüler*innen gleich behandelt Schüler*innen und dass die Älteren oft auf die Jüngeren hören – auch wenn das, was sie sagen, nicht immer Sinn ergibt.
Die Organisation der Schulgemeinde hat sich deutlich verbessert — zum Beispiel durch die Abschaffung des Rednerlistenbuchs, sodass jeder sprechen kann, ohne sich vorher anmelden zu müssen. Erst dann haben die Leute angefangen, den Redner direkt zu befragen.
Es gab Zeiten, in denen keine Schulgemeinden stattfanden, sondern stattdessen die sehr wichtige Arbeitsgruppe “Über die Schulgemeinde: was sie ist und was sie will.” Der Antrag wurde von Herrn D. Meyer (OSO) und Götz (K, OSO) eingereicht. Diese Gruppe bildete das Hauptfundament unserer Verfassung. Ihre Ziele waren:
Uns stärker mit unserer Gemeinschaft zu verbinden.
Ist es unsere Regierungsform?
Waren frühere Schulgemeinden wirklich so schlecht? In der Diskussion wurden mehrere Gründe genannt. Einige sagten, sie seien nicht gut vorbereitet gewesen und hätten der Diskussion nicht folgen oder gar nicht daran teilnehmen können. Andere sagten, dass Entscheidungen in der Schulgemeinde nur präsentiert, aber nicht diskutiert worden seien. Einige Schüler*innen , dass man zwar etwas sagen und verbindliche Entscheidungen treffen konnte – aber nicht lachen oder scherzen durfte. Man musste den Vorschlag des Mitarbeiters unterstützen, wenn man ihn nicht untergraben wollte.
Zwei Schüler*innen :
Das Wahlrecht muss man sich verdienen. Sie dachten, das mache die Stimmen aussagekräftiger, aber da keine Abstimmungen mehr stattfinden, wird es abgeschafft.
Das Wahlrecht spielt keine Rolle mehr, da keine Abstimmungen mehr stattfinden — also wird es abgeschafft.
Genauso einfach könnten wir die Schulgemeinde aufgeben, wenn sie keinen Zweck mehr erfüllt. Schon jetzt gibt es eine starke Tendenz, sie durch Diskussionen in kleineren Gruppen zu ersetzen, da sie als Leitungsgremium als zu umständlich angesehen wird. Wir haben Arbeitsgruppen (nach Altersgruppen), und besonders wichtige oder komplexe Themen werden in diesen diskutiert. Herr Beyer schlug vor, dass alle Themen in den Familien besprochen werden sollten, die dann Vertreter zu einer Art Parlament schicken würden, das mit Paulus berät und Entscheidungen trifft. Die Idee eines Parlaments wurde abgelehnt, da die Schulgemeinde nicht einmal dazu befragt worden war. Dennoch eignen sich die Familien gut zur Erörterung von Schulangelegenheiten und sollten noch stärker genutzt werden.
In Goldern weigerte sich Paul Geheeb längere Zeit, Schulgemeinden abzuhalten, da er die Gemeinschaft für nicht reif genug hielt. Unter dem Druck der Schüler wurden sie in den 1950er Jahren wieder eingeführt.
Als Ruth Cohn 1974 ihre Arbeit als Beratungsexpertin bei uns aufnahm, erforschten wir gemeinsam mit ihr alle Aspekte des Lebens in Gruppen. Eine solche Gruppe beschrieb sich selbst auf eine Weise, die auch heute noch auf viele Schulen zutrifft. Punkt 1 lautete: “Politische Bildung – oder was habt ihr gedacht?” Eine “Schule der Menschlichkeit” beschäftigt sich angeblich mit Brot- und Waffenhandel im Atelier, mit “nationaler Aktion” – wie sollen wir das Einwanderungsproblem legal lösen – Politik, wollen wir das überhaupt? (Zwei, viel zu wenige.) Aber es gibt auch klare Grenzen für die Schulgemeinde: Beteiligung hat Grenzen – Sicherheit, Gesundheit, Gesetze und das Kernkonzept der Schule.
Politische Themen, die kürzlich an unserer Schule diskutiert wurden, waren: Umweltschutz, Amnesty International, Atomkraft, Berufskrankheiten usw.
In der Schulgemeinde wird nicht abgestimmt. Das wäre unsinnig – in einer Versammlung aller Schulmitglieder, etwa 100 Personen. Ziel ist es, sich in einer gemeinsamen Diskussion so lange auszutauschen, bis eine Lösung gefunden ist, die alle akzeptieren können. Der Schulgemeinde-Leiter hat die anspruchsvolle Aufgabe, “das Gefühl der Sitzung” zu erspüren, den gemeinsamen Nenner – das, was alle wirklich wollen. Das ist natürlich viel schwieriger und zeitaufwändiger (aber letztendlich demokratischer) als eine Abstimmung, bei der eine 51-prozentige Mehrheit eine 49-prozentige Minderheit überstimmt.
Oft fällt es der Schulgemeinde schwer, sich eine klare Meinung zu bilden: sie ist zu groß. In solchen Fällen müssen Entscheidungen in kleineren Gruppen getroffen werden, die ebenfalls nach dem Konsensprinzip arbeiten. Dennoch bleibt die Schulgemeinde eine sehr wichtige Institution: Oft wird ein Thema jedem Schulmitglied während einer Sitzung wirklich klar, und aus der Diskussion lässt sich oft die Richtung erkennen, in die eine Entscheidung gehen sollte.
— Armin Lüthi (M 4.48–3.50, seit 4.56)
Schulgemeinde als Schwelle zwischen individuellem Willen und gemeinschaftlichem Denken
Nach dem Aufräumen am Freitag gab es Zeit für Tee, dann gingen wir in die Aula zur Schulgemeinde – sie war ein wichtiger Bestandteil des wöchentlichen Rituals an der Ecole. Wir kamen zusammen und tauschten Gedanken aus – ähnlich wie beim Singen am Samstagmorgen oder bei der Andacht am Sonntagabend. Diese Zusammenkünfte fühlten sich wie ein zentraler Bestandteil jeder Gemeinschaft an: von den “Town Hall Meetings” der Pioniersiedlungen in den USA bis hin zu den Dorfversammlungen in den südlichen Teilen Europas – so haben sich Gemeinschaften seit der Antike versammelt.
Es fiel mir zum Beispiel schwer, die Flüsterer in der letzten Reihe zur Ordnung zu rufen – sie sollten lernen, wie Paulus zu sagen pflegte, “sich mit Würde zu langweilen.” Das waren Paulus’ unvergessliche Worte. Gleichzeitig war er besorgt, dass zu viel Demokratie zu Chaos führen könnte. Zu viel Gerede und Exzesse bei unseren gemeinschaftlichen Zusammenkünften, veranschaulicht am Beispiel des Drei-Welten-Essen, könnten auch abschreckend wirken. Die Schulgemeinde-Sitzungen konnten so intensiv werden, dass viele sich überwältigt und müde fühlten – auch wenn sie sehr stark an der Diskussion beteiligt waren.
“Reden in der Öffentlichkeit”, die Kunst, in der Öffentlichkeit zu sprechen, habe ich in vielen Schulgemeinde-Sitzungen während meiner Zeit an der Ecole gelernt. Ich musste es lernen – auch wenn ich nicht immer sprechen wollte. Besonders wenn etwas Wichtiges besprochen wurde, ich aber noch nicht bereit war, mich zu äußern – es hat mir trotzdem geholfen: Ich hatte keine Angst mehr, mich zu Wort zu melden und meine Meinung zu sagen.
Eine Erinnerung ist mir besonders in Erinnerung geblieben: eine Schulgemeinde, in der ich eine Ankündigung machen musste – über die Intensivwoche, meine Betreuungsaufgabe oder über die Lösung eines bestimmten Problems. So viel vom Leben lernt man in einer solchen Schulgemeinde – besonders wenn man nicht nur anwesend ist, sondern sich auch aktiv beteiligt, aufsteht und sich Mühe gibt. Wer am Rande steht, hat oft das Gefühl, dass nichts passiert.
Rückblickend betrachte ich die Schulgemeinde als eine Art Kompass inmitten des täglichen Trubels, als Schwelle zwischen individueller Absicht und gemeinschaftlichem Denken – als wesentlichen Bestandteil der Integrität der Ecole. Für viele Schüler*innen diente sie auch als „Sicherheitsventil“, wo sie ihre Frustrationen oder ihre „Bereitschaft zum Aufbegehren“ zum Ausdruck bringen konnten. Wenn man offen darüber sprechen kann, ohne bestraft oder als Unruhestifter abgestempelt zu werden, dann ist bereits ein erster Schritt zur Deeskalation der Situation getan.
— Kim Dios, Arizona, USA (M 9.95–8.99)
Aktuelle Schulgemeindeleiter im Gespräch
Jonas, du leitest die Schulgemeinde seit fast dreieinhalb Jahren, und seit Herbst 2003 bist du, Sophie, in der Leitung dabei. Was macht dir an der Rolle Spaß?
Jonas: Ich freue mich, wenn es mir gelingt, mit meinen Interventionen die Diskussion voranzubringen und dadurch lebhafte, freundliche Gespräche zu ermöglichen – Diskussionen, an denen auch ruhigere Schüler*innen teilnehmen und sich äußern Schüler*innen . Besonders schön ist es, wenn ein kleiner Konflikt zu einer klaren Lösung gebracht werden kann. Das ist die positive Seite von Interventionen. Die Kehrseite ist, dass ich oft Kritik dafür bekomme, wie viel ich rede.
Sophie: Für mich ist es spannend herauszufinden, was wirklich hinter einem Konflikt steckt. Eine große Herausforderung ist es, diese Rolle als Schülersprecherin auszufüllen. Das ist ein Balanceakt: Wie gehe ich zum Beispiel mit Mitarbeitern um, die sich gegenseitig etwas zuflüstern?
Welche Eigenschaften braucht man für eure Rolle?
Sophie: Respekt von Schüler*innen Mitarbeitern – und Klarheit: meine verschiedenen Rollen nicht zu vermischen. Deshalb mache ich immer deutlich, wann ich als Schulgemeinde-Leiterin spreche und wann ich nur eine Mitschülerin bin.
Jonas: Ja, und man muss auch hinter seiner Rolle stehen und die Idee der Schulgemeinde grundsätzlich unterstützen, da man als Leiter Teil dieser Struktur ist.
Wie hast du die Schulgemeinde erlebt, bevor du Leiter wurdest?
Sophie: Früher war ich nur eine von vielen Schüler*innen und ziemlich passiv. Als Führungskraft erlebe ich das jetzt viel bewusster.
Jonas: Seit ich Leiter bin, bemerke ich sehr starke Phasen in mir selbst – zum Beispiel, wenn ich mich meinen Mitschülern verpflichtet fühle und mehr als andere rede. Früher fand ich das nervig. Jetzt verstehe ich, dass es oft mit dem Thema zusammenhängt.
Sophie: Und es ist anstrengend, eine Schulgemeinde wieder in Ruhe und Konzentration zu führen, wenn Störungen aus Langeweile kommen.
Jonas: Meine Fähigkeit, mich mit Würde zu langweilen, hat sich definitiv verbessert.
Wann entsteht Langeweile deiner Meinung nach am ehesten?
Jonas: Generell ist es ein Problem, wenn Ankündigungen an die ganze Gemeinschaft gerichtet sind – dann fühlt sich niemand wirklich angesprochen. Und wenn Punkte schlecht vorbereitet sind, raubt das Energie.
Sophie: Es gibt Ankündigungen, die sich ständig wiederholen, wie Reisebestimmungen oder Sicherheit beim Wandern. Das macht es schwer, die Aufmerksamkeit der Leute zu halten. Aber diese Ankündigungen sind trotzdem notwendig.
Habt ihr dafür eine Lösung?
Sophie: Teilweise hängt es mit der Art der Traktanden zusammen – Themen, die die Bedürfnisse aller betreffen, werden lebendiger und realer diskutiert.
Jonas: Ich fand die Diskussion über das „Three Worlds Dinner“ ausgezeichnet – sehr lebendig und bedeutungsvoll. Es ging darum, wie man globale Ungleichheit im Konsum von Lebensmitteln innerhalb unserer eigenen Gemeinschaft anhand eines Abendessens erfahrbar machen kann. Die Diskussion dauerte so lange und intensiv, dass viele nach der Sitzung noch blieben, um weiterzudiskutieren.
Sophie: Was mich stört, ist, wenn Schüler*innen : „Es hat keinen Sinn, meine Anliegen vor die Schulgemeinde zu bringen.“
Jonas: Es wird viel gemeckert, aber nichts unternommen: Alle wollen nach Meiringen (Anmerkung der Redaktion: Nur Schüler*innen 17 dürfen alleine nach Meiringen fahren, jüngere Schüler*innen von Mitarbeitenden begleitet werden), aber niemand bringt dieses Thema in der Schulgemeinde zur Sprache.
Ein Teil des Problems sind nicht nur die Themen selbst, sondern auch, wie sie vorbereitet werden. Manchmal kann es hilfreich sein, radikalere Lösungen vorzuschlagen. Wenn wir erneut erklären müssen, dass die Milchbar Personal braucht und dass die Mitarbeiter*innen das nicht alleine schaffen, sollten wir sie vielleicht einfach für eine Weile schließen. Die Milchbar würde wahrscheinlich mehr vermisst werden, wenn Schüler*innen einspringen Schüler*innen , um sie zu unterstützen. Gleichzeitig ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu wahren und nicht ständig mit Drohungen oder Horrorszenarien zu arbeiten. Das hilft nicht weiter.
Sophie: Jedes Mal, wenn alle Freitagsgruppentreffen wieder angekündigt werden, frage ich mich warum. Das passiert meistens am Ende der Schulgemeinde. Alles in allem finde ich, dass wir die Schulgemeinde stärker einschränken sollten. Manchmal dauert sie anderthalb Stunden, und dann kann sich niemand mehr konzentrieren.
Jonas: Und wir sind auch auf die Leute angewiesen, die Traktanden einreichen: Ihre Zeitschätzungen sind oft vage. Zuerst sagen sie „nur kurz“, und dann dauert es sieben Minuten.
Sophie: Seit Sonia (Benenson, K 9.65–6.67, 9.70–6.72, M seit 8.99) die deutschen Beiträge simultan ins Englische übersetzt, sollten Traktanden idealerweise auf Deutsch präsentiert werden. Das spart viel Zeit und Energie – auch wenn Englischsprachige auf Englisch vielleicht besser erreicht werden.
Wie empfindest du die Beteiligung deiner Schüler*innen?
Sophie: Mein Eindruck ist, dass viele sehr engagiert sind, wenn sie mit ihren Nachbarn reden, aber viel weniger den Mut haben, aufzustehen und ihre Meinung vor allen zu vertreten.
Jonas: Das ist schwierig. Solange ich nur „leite“, bin ich nicht nervös – aber wenn ich meine eigene Meinung äußern will, werde ich sehr nervös.
Sophie: Man könnte dafür angegriffen werden.
Hast du dich jemals in der Schulgemeinde hingestellt, um deine Meinung zu sagen?
Jonas: Ich habe das nie gemacht – obwohl ich die Schulgemeinde immer mochte, habe ich mich nie getraut, etwas zu sagen.
Sophie: Ja, das habe ich. Es ging darum, den Abendplan wieder auf die ursprüngliche Zeit zurückzusetzen – von 18:30 Uhr auf 18:40 Uhr. Ich erinnere mich noch gut daran, weil es plötzlich zu einer echten Konfrontation kam: Schüler*innen Mitarbeiter*innen.
Jonas: Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits Schulgemeinde-Leiter. Es war sehr schwierig, eine sinnvolle Lösung zu finden. Die Positionen waren festgefahren: Die Schüler*innen 10 Minuten mehr Freizeit zwischen Abendessen und Quiet Hour, und die Mitarbeiter*innen brauchten nach dem Unterricht genügend Zeit, um vor dem Abendessen aufzuräumen. Eigentlich war von Anfang an klar, wie die Sache ausgehen würde: mit der freiwilligen Zustimmung der Schüler*innen. Aber ich finde es ehrlicher, einfach zu sagen: „Wir machen es so und so, weil …“
Das Interview wurde geführt von: Viola Waller (M seit 9.98)
